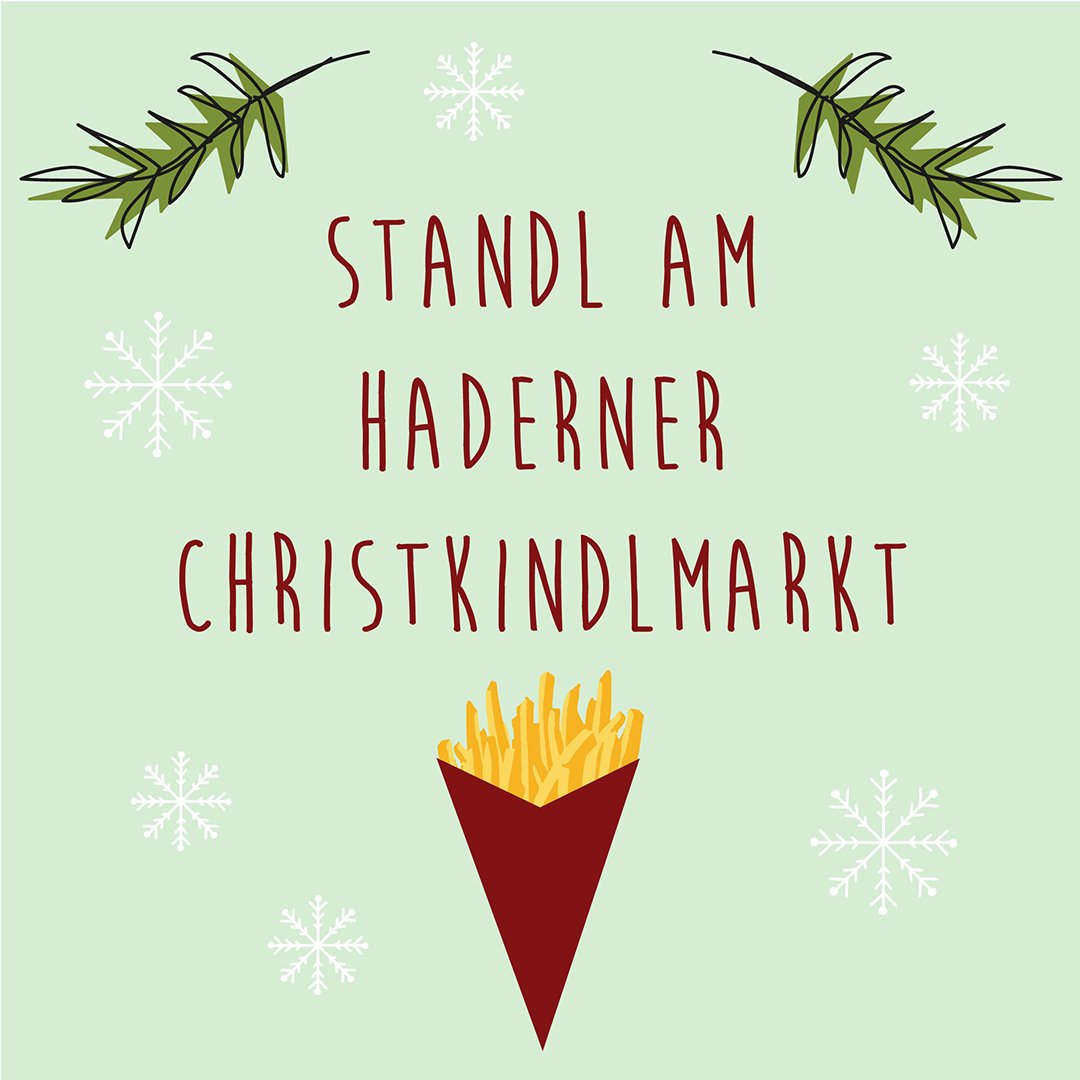»Afrikanisches Fieber« ist ein Begriff, der nicht etwa die Tropenkrankheit Malaria umschreiben soll. Vielmehr veranschaulicht er einen Prozess der Kolonialisierung von souveränem afrikanischem Gebiet durch europäische Großmächte im späten 19ten Jahrhundert. Gründe für diese Form des europäischen Imperialismus gab es viele. Zum einen suchte überschüssiges Kapital neue Investitionsmöglichkeiten. Zum anderen spielten der Wunsch nach christlicher Missionierungsarbeit sowie der einfache Eroberungsgedanke eine große Rolle. Deutscher Kolonialismus im Osten Afrikas. Angetrieben durch die wirtschaftlichen Vorteile einer Kolonie, wollte Deutschland zu Beginn der 1880er Jahre so wie Großbritannien, Frankreich, Portugal und Spanien Zugriff auf profitable Ressourcen und Absatzmärkte erhalten. Obwohl Otto von Bismarck sich außenpolitisch ausschließlich auf Europa konzentrieren wollte, musste der Reichskanzler dem enormen innenpolitischen Druck einflussreicher deutscher Unternehmer bald nachgeben. Als Folge dessen gründete der Pastorensohn Karl Peters die »Gesellschaft für deutsche Kolonisation«. Mit Hilfe deutscher militärischer Unterstützung schloss er nach seiner Ankunft diverse Verträge mit einheimischen tansanischen Autoritäten ab, die den Deutschen die Autorität über große Ländereien zusicherten. Ein Großteil des Landes war damals im Besitz des Sultans von Sansibar, der zu diesem Zeitpunkt dem Schutz Großbritanniens unterstand. Ungeachtet der militärischen Verpflichtungen dem Sultan gegenüber, vermied die britische Regierung jedoch einen Krieg mit Deutschland. Vielmehr verständigte man sich auf die noch heute gültige Grenzziehung zwischen Kenia und Tansania, die die jeweiligen Hoheitsgebiete markieren sollte. Sobald Peters die Einigung mit den Briten gelungen war, konzentrierte er sich auf seine primär zugewiesene Aufgabe, wirtschaftlichen Nutzen aus Tansania zu schlagen. Neben dem Ertrag schon bestehender Zucker und Gummibaumplantagen ließ Peters sowohl Kaffee in der Kilimanjaro Region als auch Baumwolle in der Viktoriasee Region einführen. Am ergiebigsten war jedoch die Sisal-Agavenpflanze, deren Fasern noch heute in Seilen und Teppichen verarbeitet werden. Darüber hinaus wurde ein modernes Bildungs-, und Gesundheitssystem in Tansania aufgebaut. Auch die heute noch in Betrieb stehenden Eisenbahnlinien wurden in dieser Zeit errichtet. Allerdings dienten diese weniger dem öffentlichen Transport in ansprechende Urlaubsregionen, als vielmehr dem Transport der angebauten Agrarprodukte in Richtung Hafen.
Tragische Revolte. Die deutsche Administration war auf Grund ihrer harschen Arbeitspolitik sowie der Einführung einer »Hütten-Steuer«, unter den Einheimischen äußerst unpopulär. Aus dieser Unzufriedenheit resultierte alsbald ein blutiger Aufstand einiger Stämme. Zum Leid der Afrikaner reagierte die Kolonialmacht mit einer verheerenden Maßnahme: Die Verbrennung eines Großteils der Getreidefelder brachte eine Hungersnot hervor, die den Tod von über 250.000 Menschen forderte. Dafür wurde Karl Peters von der deutschen Regierung zur Rechenschaft gezogen und schließlich 1906 unehrenhaft entlassen.
Unter neuer Autorität fand ein Umdenken in Bezug auf den Umgang mit der einheimischen Bevölkerung statt. Die deutsche Kolonialmacht verabschiedete beispielsweise diverse Gesetze gegen die Misshandlung von Einheimischen und begann ländliche Besitzansprüche der Afrikaner verstärkt zu respektieren.
Das Ende der Kolonie. Jegliche weiteren deutschen Kolonialambitionen wurden mit Ende des Ersten Weltkriegs zunichte gemacht. Zum Zeitpunkt der Niederlage Deutschlands fanden die Briten schließlich ein Land vor, welches unter anderem durch große Hungersnöte geplagt war. Der damals vorherrschende Völkerbund übernahm vorübergehend die Kontrolle über das Land und legte die immer noch gültigen Grenzen Ruandas und Burundis fest, welche damals Teil Deutsch-Ostafrikas gewesen waren. Beide Länder wurden der Vorherrschaft Belgiens unterstellt, während der Rest des Landes in Tanganjika umgetauft und dem Vereinten Königreich überlassen wurde.
Johannes Musiol